|
|
Lateinamerikas konkrete Alternative
Hintergrund: Das neue Sicherheitssystem gegen den Norden heißt ALBA
Gemein ist beiden Regionen gerade einmal die Metapher. »Alba«, das spanische Wort für Morgenröte
erweckt in Europa wie in Lateinamerika die gleichen Assoziationen. In beiden Kulturkreisen steht das Licht
der aufgehenden Sonne für den neuen Tag, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. An diesem Punkt aber
enden auf der Bühne der Realpolitik die Gemeinsamkeiten von Europäern und Lateinamerikanern. Bei
letzteren steht die Abkürzung ALBA für »Alternativa Bolivariana para las Américas«. Die
»Bolivarianische Alternative für die Amerikas« ist ein geopolitisches Projekt, das die Staatschefs
von Kuba und Venezuela, Fidel Castro und Hugo Chávez, Ende vergangenen Jahres aus der Taufe gehoben
haben. Das strategische Fernziel von ALBA ist, aus Südamerika einen politisch und wirtschaftlich
geeinten Machtblock zu schaffen. Er soll in der Lage sein, in einer mulitpolaren Welt die Interessen des
Kontinents zu vertreten. Historisch betrachtet, verkörpert ALBA die moderne Umsetzung von
Simón Bolívars Vorstellung der »Patria Grande«, des »großen Vaterlandes«, im 21.
Jahrhundert.
US-Hegemonie zurückgedrängt
Das Neue daran ist, daß es sich bei der ALBA um ein originär lateinamerikanisches Projekt
handelt und nicht um das Resultat der Arbeit einer beliebigen Denkfabrik auf der Nordhalbkugel. Und
obgleich die Ausgangslage eine andere ist, sind durchaus Parallelen zum westeuropäischen
Einigungsprozeß nach 1945 erkennbar. Vom Washingtoner Standpunkt aus betrachtet, hat Lateinamerika
seit dem 19. Jahrhundert wirtschafts- und militärstrategisch zur »westlichen Hemisphäre« der
US-Außenpolitik gezählt. Im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte expandierten die USA
kontinuierlich in ihrem »Hinterhof« – zum Wohlgefallen der heimischen Wirtschaft. Und bis ins neue
Jahrtausend waren die Vereinigten Staaten in der Lage, südlich des Rio Bravo ihre politischen und
wirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen – notfalls mit Gewalt – durchzusetzen.
Noch im Jahr 2000 sah es so aus, als ob die mittlerweile einzige Weltmacht fähig wäre, ihre
Wunschvorstellung von der gesamtamerikanischen Freihandelszone ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas), die nach Wünschen William Clintons »von Alaska bis Feuerland« reichen sollte, bis
2005 umzusetzen. Der Plan entstand in den neunziger Jahren in den neokonservativen Think-tanks der USA.
Sein geostrategisches Ziel war es, den Einfluß des europäischen und chinesischen Kapitals auf
beiden amerikanischen Kontinenten, aber vor allem aus Südamerika, zurückzudrängen.
Gute Erfahrungen hatte Washington in dieser Hinsicht mit der »Nordamerikanischen Freihandelszone« NAFTA
gemacht, die neben den USA auch Mexiko und Kanada umfaßt. Nach Inkrafttreten am 1. Januar 1994
brachen die Importe europäischer Güter ein. An ihre Stelle traten die Einfuhren aus den
NAFTA-Mitgliedsstaaten. US-Firmen siedelten nach Mexiko, wo sie billiger produzieren konnten. NAFTA war
für die US-Handelspolitik ein Instrument, um den Vormarsch der EU als weltgrößter
Handelsmacht in jener Region zu bremsen. Brüssel versuchte, das verlorene Terrain wettzumachen,
indem man Mexiko-Stadt und Ottawa eigene Freihandelsverträge anbot. In Mexiko gelang dies – auch dank
der starken Präsenz deutscher Unternehmen vor Ort. Mit Kanada ziehen sich die Verhandlungen in die
Länge, weil im Hintergrund der nicht erklärte Handelskrieg zwischen den USA und der EU tobt.
Mit ALCA würde Washington Brüssel ein zweites Mal zurückdrängen. Die absehbaren
negativen Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen mit der EU lassen vor allem Brasilien und Kanada
zögern, dem Plan der bikontinentalen Freihandelszone »made in USA« zuzustimmen.
Hinzu kamen die schlechten Erfahrungen mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die ALCA in alle Staaten
Amerikas hineintrüge: die mexikanischen Bauer machten die bittere Erfahrung, daß sie mit den
subventionierten Grundnahrungsmitteln aus den USA ohne den Schutz von Zöllen nicht konkurrieren
konnten. Die bis dato als wohlhabend geltenden Argentinier erlebten mit dem Zusammenbruch ihrer Wirtschaft
2001/2002 die schwarze Seite des Neoliberalismus. Und in Venezuela war der »Caracazo« in schlechter
Erinnerung geblieben, jener Sozialaufstand, der 1989 in der Hauptstadt ausbrach, als der
sozialdemokratische Präsident Carlos Andrés Pérez auf Anweisung des Internationalen
Währungsfonds die Subventionen für Grundnahrungsmittel und den öffentlichen Nahverkehr
ersatzlos strich. Den Hungertod vor Augen, stürmten die Armen die Supermärkte der Hauptstadt.
Der Präsident ließ sie vom Militär zusammenschießen. Die Angaben über die Opfer
schwanken zwischen 300 und 3 000 Toten.
Wege aus dem neoliberalen Elend
Die katastrophale soziale wie politische Lage in dem südamerikanischen Land trug nach dem »Caracazo«
maßgeblich zum Zerfall der etablierten Parteien und damit 1998 zur Wahl Hugo Chávez' zum
Präsidenten bei. Als dieser 2001 beim Amerikagipfel in Quebec sein Veto gegen ALCA explizit
schriftlich festhalten ließ, nahmen ihn politische Beobachter noch nicht ernst. Der Tübinger
Politologe Andreas Boeckh sah Chávez' Venezuela auf dem Weg »Von einer ›Chaosmacht‹ zu einer
regionalen Mittelmacht und wieder zurück«.
Solche Analysen zeugten vom gewohnt paternalistischen Umgang mit der sogenannten dritten Welt. »Hilfe zur
Selbsthilfe« lautete die Devise, die in den achtziger Jahren die christlichen Kirchen in Westdeutschland
predigten, damit Jugendliche und ihre Eltern so manche D-Mark und Arbeitsstunde spendeten, um den »armen«
Lateinamerikanern zu helfen. Die Unterstützung war projektorientiert, griff aber niemals die Probleme
an der Wurzel an. Die jüngste Geschichte zeigt, daß es des Wahlsieges von Hugo Chávez
bedurfte, damit Lateinamerikaner ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen konnten. Chávez suchte
rasch nach Verbündeten und fand einen ersten Partner in Kuba. Zunächst beschränkte sich die
bilaterale Zusammenarbeit auf die Gesundheits- und Bildungspolitik sowie wirtschaftliche Hilfe. Kuba
tauschte sein Know-how gegen Erdöl. Die bolivarische Republik erhielt spanischsprechendes
Fachpersonal, das nicht gegen teure Devisen im kapitalistischen Norden angeworben werden mußte.
Kubas Beispiel in Venezuela hat gezeigt, daß seine Alphabetisierungsmethoden zum Erfolg führen
und daß sein Gesundheitssystem kompatibel mit den Gegebenheiten in den Armenvierteln auf dem
Kontinent ist. Venezuela bewies, daß der solidarische Tauschhandel – in seinem Fall Erdöl gegen
Dienstleistungen oder Fertigprodukte – als eine neue Form des Wirtschaftens jenseits des Kapitalismus
funktionieren kann.
Kontrolle des natürlichen Reichtums
So wurde die Grundlage für die strategische Achse Caracas-Havanna gelegt. Aus ihrer Dynamik entstand
im Dezember 2004 die »Alternativa Bolivariana para las Américas«. ALBA nimmt die Grundübel ins
Visier, mit denen alle lateinamerikanischen Staaten zu kämpfen haben: Armut, Nahrungsmittelknappheit,
Krankheiten, Analphabetismus, fehlender Zugang zu Fachwissen und Technologie, Arbeitslosigkeit,
schwindende Kontrolle über die Bodenschätze, hohe Auslandsverschuldung.
Die erste Lehre aus Venezuela und Kuba ist, daß jeder Staat Herr im eigenen Haus sein, also die
natürlichen Reichtümer selbst verwalten muß, damit er mit den Verkaufserlösen seine
Sozialpolitik finanzieren kann. Das bedeutet aber nicht, daß die kubanische und venezolanische
Strategie per se auch auf die anderen südamerikanischen Staaten zu übertragen ist. Evo Morales
hat den mutigen Schritt gewagt, als er Anfang Mai die bolivianische Erdöl- und Gasindustrie
verstaatlichte und die ausländischen Investoren zwang, neue Verträge auszuhandeln. Einen
ähnlichen Konflikt hatte es in Venezuela gegeben, wo nur ein US-amerikanischer und ein italienischer
Konzern es ablehnten, ihre Kooperation mit dem staatlichen Energieversorger PDVSA neu zu gestalten. In
Argentinien etabliert Néstor Kirchner neben den ausländischen Ölfirmen, die von der
neoliberalen Privatisierungsorgie der neunziger Jahre profitiert hatten, wieder öffentliche
Unternehmen – ohne Verstaatlichungen.
Diese Wirtschaftsmaßnahmen im nationalen Rahmen bilden die Grundlage für die bilateralen,
regionalen und kontinentalen Gemeinschaftsprojekte, die dem politischen und sozialen Anspruch von ALBA
entsprechen.
Energie für die regionale Integration
In der eingeläuteten Endphase der Petroära lassen sich mit dem Verkauf von Erdöl und Gas
exorbitante Gewinne erzielen. Andererseits bedingt der hohe Ölpreis und der von den USA unilateral
durchgesetzte Zwang, das schwarze Gold nur gegen US-Dollar zu erwerben, daß finanzschwache Staaten
den für ihre Wirtschaft so lebenswichtigen Stoff nur im geringen Umfang ankaufen können. Daher
setzt ALBA im Rahmen der industriellen Integration ihr Augenmerk derzeit auf die Energieversorgung
Lateinamerikas und der Karibik. Nur noch eine Frage der Zeit ist es, wann mit dem Bau einer enormen
Gaspipeline begonnen wird, die von Venezuela über Brasilien und Uruguay bis nach Argentinien
führen wird. Parallel zu diesem Projekt prüfen Fachleute, ob es möglich ist, eine zweite
Gaspipeline zu bauen, die Venezuela, Bolivien, Paraguay und Uruguay miteinander verbindet.
Gleichzeitig laufen zahlreiche Projekte zwischen den staatlichen Energieunternehmen an. Die venezolanische
PDVSA will mit dem staatlichen kubanischen Energieunternehmen Cupet eine alte Raffiniere in Cienfuegos
wieder in Betrieb nehmen. Das Vorhaben hat strategischen Charakter. Zwei Raffinerien für
venezolanisches Erdöl befinden sich unmittelbar vor der Küste auf den Inseln Aruba und Curacao,
die aber zu den Niederlanden gehören. Da Den Haag sich in den letzten Jahren als
Washington-freundlich gezeigt hat, wenn es um die Stationierung von US-Streitkräften auf den Eilanden
ging, sucht Caracas aus Gründen der nationalen Sicherheit nach Alternativen. Des weiteren kooperiert
PDVSA mit der brasilianischen Petrobras, der paraguayischen Petropar sowie mit ihren staatlichen Pendants
in Bolivien und Argentinien.
Über die Firma Petrocaribe tauscht PDVSA mit den Karibikstaaten Erdöl gegen Naturalien und
Dienstleistungen oder gewährt besonders günstige Kredite. Das langfristige Ziel der neuen
Energiepolitik ist die Bildung eines kontinentalen Energieunternehmens. »Petrosur« soll
südamerikanisches Erdgas und Erdöl weltweit zu Preisen anbieten, die dieser multinationale,
staatliche Konzern besser verteidigen kann, als es die Einzelunternehmen könnten. Seit seiner
Amtsübernahme versucht Chávez, auch die Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC)
für seine neue Sozialpolitik einzusetzen.
Allseitige Unabhängigkeit
Das ist nötig, denn die Auslandsschulden lasten schwer auf den lateinamerikanischen Staaten. Der Bau
der erwähnten Gaspipelines bedarf überdies zusätzlicher Finanzierung durch Bankkredite. Da
man sich im Sinne von ALBA auch vom Diktat der Kreditinstitute des Nordens befreien möchte, ist eine
eigene Entwicklungsbank nötig. Chávez hat bereits laut die Gründung einer »Banco de Sur«
angedacht. Das benötigte Geld könnte auch aus den venezolanischen Devisenreserven kommen. Die
28 Milliarden US-Dollar liegen nicht mehr in den USA, sondern wurden unter anderem in die EU und auf
Schweizer Konten transferiert. Interesse an dem Projekt haben auch arabische Investoren angemeldet, denen
die USA aufgrund der antiarabischen Stimmung seit dem 11. September 2001 nicht mehr geheuer sind. Zur
lateinamerikanischen Selbstfinanzierung – und zur venezolanischen Außenpolitik – gehört
ebenfalls, daß Caracas einen Teil der argentinischen Auslandsschuld übernahm, was Buenos Aires
ermöglichte, seine Schulden beim IWF drastisch zu reduzieren.
Und schließlich geht es um die Informationspolitik. »Unser Norden ist der Süden«, lautet der
Wahlspruch von Telesur, wobei das spanische Wort »norte« sowohl »Norden« als auch »Ziel« bedeutet. Der
Fernsehsender ist angetreten, um Lateinamerika mit Informationen zu versorgen, die weder die spanische
Ausgabe von CNN noch die privaten Medien in den jeweiligen Ländern zu senden pflegen. Telesur
entstand vorwiegend mit venezolanischem Kapital. Zu den Anteilseignern gehören Argentinien, Kuba und
seit kurzem auch Bolivien. Neben diesem kontinentalen Projekt versuchen die einzelnen Staaten auf
nationaler Ebene, der Vormachtstellung der privaten Medien, die zumeist von der Oligarchie kontrolliert
werden, mittels Bürgerfunk eine Alternative von unten entgegenzustellen. Dabei blieb es aber nicht:
Bei der diesjährigen 15. Internationalen Buchmesse in Havanna brachten Chávez und Castro die
»Casa del ALBA« auf den Weg. Das »ALBA-Haus« soll ein multinationales Kulturunternehmen werden, das Musik,
Kunst, Literatur und Handwerk aus Lateinamerika weltweit vertreibt. Um auch hier das Fastmonopol der
Branchenriesen aus dem Norden zu unterlaufen, riefen die beiden Erschaffer von ALBA außerdem noch
einen Verlag und ein Musiklabel ins Leben.
Auch EU vor neuer Situation
Während die Neokonservativen in den USA das ALCA entwickelten, entstand in der Europäischen
Union ein vergleichbares Projekt: die »strategische Partnerschaft«. Beide Vorhaben stehen in direkter
Konkurrenz zueinander. Die Transatlantiker innerhalb der EU halten zumindest bei der Sicherheitspolitik
einen Dreierbund EU, USA und Lateinamerika für möglich. Die Europäisten zögen dieser
Perspektive eine Kooperation mit Lateinamerika auf der Basis eines Freihandelsabkommens vor. Auch diese
Wunschvorstellungen kollidieren mit der Realpolitik. Zum einen hat Chávez vor wenigen Wochen den
Austritt seines Landes aus der Andengemeinschaft angekündigt, weil Kolumbien und Peru mit den USA ein
Freihandelsabkommen im Sinne von ALCA geschlossen haben. Damit ist nach der Organisation Amerikanischer
Staaten (OAS) eine weitere interamerikanische Institution schwer angeschlagen und hat für
Ansprechpartner wie die EU nur noch einen sehr begrenzten Wert. Früher oder später wird zudem
die 2004 gegründete Südamerikanische Staatengemeinschaft CSN (1) die von den USA an der kurzen
Leine gehaltene OAS als politische Vertreterin ablösen.
Zum anderen ist in der südamerikanischen Handelszone Mercosur eine Debatte über die Gestaltung
des gemeinsamen Marktes entbrannt, weil sich Uruguay und Paraguay von den Wirtschaftsmächten
Brasilien und Argentinien benachteiligt fühlen. So erklärt sich, warum es der EU beim
jüngsten Lateinamerika-Gipfel in Wien nicht gelang, die festgefahrenen Verhandlungen mit den
Mercosur-Staaten über einen Freihandelsvertrag wieder anzuschieben.
Mit dem Beitritt Boliviens zur ALBA und dem Abschluß des »Handelspaktes der Völker« entwickelt
sich die »Alternativa Bolivariana« zu einem außen- und wirtschaftspolitischen Sicherheitssystem,
das sich wappnet, die unterschiedlichen Revolutionen in Kuba, Venezuela und Bolivien vor Angriffen aus
dem Norden zu schützen.
Anmerkung:
1 Mitgliedsländer der CSN sind die Staaten der Andengemeinschaft (Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru,
Venezuela), die Mitglieder des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) und andere Staaten,
die zuvor keiner der beiden genannten Gemeinschaften angehörten (Chile, Guyana, Surinam)
 Ingo Niebel
Ingo Niebel
Junge Welt, 13.06.2006
|








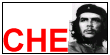


|

