|
|
Mit dem Holocaust gegen Kuba
In der nächsten Woche wird die US-Blockade gegen die Insel in der UNO verurteilt werden – wie jedes Jahr.
Wenn Anfang kommender Woche die Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammenkommt, um über die
US-Blockade gegen Kuba zu beraten, steht das Ergebnis – wie seit Jahren – fest: Eine überwältigende
Mehrheit der UNO-Mitglieder wird die aggressive Politik Washingtons gegen Havanna verurteilen. Im letzten
Jahr taten dies bereits 183 der 194 Mitgliedsstaaten, Tendenz steigend. Ungeachtet des immensen Drucks
stellt sich die US-Regierung stur. Die völkerrechtswidrige Blockade wird beibehalten.
Erst der zweite Blick in die USA zeigt: Seit Jahren kämpft dort eine Handvoll Abgeordnete der
Demokratischen Partei für eine Annäherung an das sozialistische Kuba. Seit die Demokraten wieder die
Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses kontrollieren, ist durch ihr Engagement sogar eine
bescheidene Diskussion über die Kuba-Politik aufgekommen. Im Januar hatte Charles Rangel, ein langjähriger
Demokratischer Abgeordneter aus New York, eine Beschlußvorlage in das Repräsentantenhaus eingebracht, die
auf eine Erleichterung des Handels zwischen beiden Ländern abzielte. Mit der Mehrheit seiner Partei im
Rücken schien der Erfolg sicher. Doch am Tag der Entscheidung, dem 3. August, gab es lange Gesichter: 66
Abgeordnete der Demokraten hatten die Seite gewechselt und gegen den Antrag gestimmt. Hinter dem Schwenk
steckte vor allem eine junge jüdische Abgeordnete aus Florida. Debbie Wasserman Schulz meinte, mit dem
Verweis auf den Holocaust (»Das darf nie wieder passieren!«) nun die Menschenrechte in Kuba schützen zu
müssen. Durch intensive Lobbyarbeit – und Spenden von Exilkubanern – hat sie etliche Parteifreundinnen
und -freunde umgestimmt.
Es war wie ein Déjà-vu: Auch beim Irak-Krieg haben es die Demokraten bislang nicht geschafft, eine
profilierte Oppositionspolitik zur Regierung zu entwickeln. Die Mehrheit ihrer Spitzenpolitiker will
offenbar vermeiden, im beginnenden Wahlkampf als unpatriotisch dargestellt zu werden.
Ende August hat sich auch der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Barack Obama, in
Sachen Kuba-Politik wortstark in die Debatte eingemischt. »Eine demokratische Öffnung Kubas sollte das
allerwichtigste Ziel unserer Politik sein«, sagte er. Obama möchte einerseits »Freiheit« auf der Insel
erreichen und andererseits über die »Demokratisierung« Kubas nach dem Abtritt Fidel Castros verhandeln.
Bushs Kuba-Politik, sagt der Oppositionspolitiker, bestehe aus großen Gesten, mache die Kubaner aber
abhängiger von der derzeitigen Regierung. Kritisiert wird etwa die Beschränkung von Geldüberweisungen von
Familienangehörigen in den USA nach Kuba, oder der restriktivere Umgang mit Reisen auf die Insel. Der
Demokrat hingegen will »helfen, das kubanische Volk unabhängiger von seiner Regierung zu machen«. Mittel
dazu sei eine »aggressive Diplomatie«: »Wenn eine Regierung nach Fidel Castro Kuba für demokratische
Reformen öffnen sollte, dann sind die USA bereit, eine Normalisierung der Beziehungen einzuleiten«, sagte
er – eine Lockerung des Embargos eingeschlossen. Mit Obama würde also mehr Pragmatik ins Weiße Haus
einziehen, jedoch kein grundsätzlicher Politikwechsel.
Auf einer Wahlkampftour durch Florida hat sich am 8. September aber auch ein anderer Präsidentenanwärter
der Demokratischen Partei zur Kuba-Politik geäußert, und zwar erstaunlich klar. Wenn er Präsident würde,
sagte der langjährige Senator Christopher Dodd, würde er das Jahrzehnte währende »Embargo« gegen Kuba
aufheben, die Reisebeschränkungen lockern, das aggressive Helms-Burton-Gesetz aufheben, die antikubanische
Fernsehstation TV Marti auflösen, normale diplomatische Beziehungen aufnehmen und die Beziehungen zu
Havanna verbessern. Von dem Ziel eines Systemwechsels nimmt aber auch er keinen Abstand. Trotzdem steht
er mit seiner Linie aussichtslos dar. Die exilkubanische Lobby wird einer solchen Annäherung hartnäckigen
Widerstand entgegensetzen.
 Edgar Göll
Edgar Göll
Neues Deutschland 24.10.2007
|








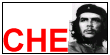


|

