|
|
Zeit des Nach- und Überdenkens in Kuba
Breite Debatte über gesellschaftliche Entwicklung / Probleme werden offen angesprochen
In Kuba hat das 50. Jahr seit dem Sieg der Revolution begonnen. Das Land kann auf so manchen Erfolg
verweisen. Aber vieles, darin ist man sich einig, muss anders werden.
Kuba ist seit 17 Monaten belastet mit einer ungelösten Frage: Wie sieht Fidel Castros politische Zukunft
aus? Das will nicht nur die mexikanische Agentur Notimex beobachtet haben. Aber es sind fast nur
Ausländer, die diese »Belastung« in den Vordergrund stellen. Die Kubaner sind inzwischen davon überzeugt,
dass der Comandante wiederkommt – ohne seine frühere ämterfülle natürlich.
Außerdem, so finden sie, habe er durch seine Artikel (über 70 wurden während seiner Krankheit bereits
veröffentlicht) gezeigt, dass er von seiner Fähigkeit als Denker und Stratege nichts eingebüßt hat. Er
werde weiter gebraucht. Raúl Castro und sein Kollektiv hätten zwar ihre Sache sehr gut gemacht, aber wer
glaubt schon, dass sie schwerwiegende Dinge angepackt haben, ohne den Comandante zu konsultieren.
Die Auslandspresse zitiert immer wieder die selbstkritischen Teile aus der Rede Raúl Castros vom 26. Juli
vergangenen Jahres, wobei sie bewusst oder unbewusst die Tatsache unterschlägt, dass es eben Fidel Castro
war, der am 17. November 2005 die nationale Debatte über gravierende Irrtümer, menschenverachtende
Bürokratie und Korruption angeschoben hatte, die zur Selbstzerstörung der Revolution führen könnten. Aber
im Juli 2006 wurde er zum ersten Mal operiert und gab den Stafettenstab an das von ihm ausgewählte Team
weiter. Auch solche Erkenntnisse stammen von ihm: »Unser größter Fehler war zu glauben, dass jemand wisse,
wie Sozialismus zu machen ist.« Oder: »Die Probleme der kubanischen Gesellschaft erfordern derart viele
Lösungsvarianten, wie ein Schachbrett Felder hat.«
Die Suche nach den Varianten setzte Raúl Castro fort. Fünf Millionen Kubaner haben sich an der von ihm
angeregten großen Debatte beteiligt. Sie ist öffentlich noch nicht ausgewertet, aber die Ergebnisse liegen
den zehn Parlamentskommissionen vor. Für den nur mal kurz in Kuba Vorbeischauenden ist es verblüffend,
dass kaum jemand das System in Frage stellte, obgleich gerade in letzter Zeit eine zunehmende Zahl
populärer Kubaner das Land verlässt.
Aber es wurde Tacheles geredet. Wie es ist, so soll es nicht bleiben. Ein Studentenführer fragte: »Wohin
gehen wir? Wir wissen es noch nicht. Wir nennen es Sozialismus, obgleich der Sozialismus, wie er den
klassischen Marxisten vorschwebte, nie existiert hat.« Eliades Acosta, seit ein paar Monaten Leiter der
Kulturabteilung des Zentralkomitees, räumte auf einer Internetseite ein, dass der Moment für revolutionäre
Reformen gekommen sei. Kritik müsse anerkannt werden, die Zensur sei zu begraben, vor allem solle dafür
Sorge getragen werden, dass sich die materiellen Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessern.
In Bürgerversammlungen wurden »ständige Debatten und nicht immer nur konjunkturelle« gefordert. Und ein
Akademiker meinte: »Es gibt in unserer Führung und in der Gesellschaft einen nach wie vor ausgeprägten
konservativen Sektor, und der wird nur auf den Zug der Reformen aufspringen, wenn Fidel dabei ist.«
Nie fehlten selbstverständlich die täglichen Probleme: zu niedrige Löhne, zu hohe Preise, eklatante Mängel
im Personentransport. Der allerdings wurde in den letzten Monaten durch den Einsatz hunderter chinesischer
Busse und Eisenbahnwaggons sowie Dutzender Lokomotiven erträglicher. Zu lang sind nach wie vor die
Wartezeiten in den Polikliniken, denn etwa 40 000 ärzte und Krankenpfleger arbeiten im Ausland und bringen
dem Staat damit Millionen an Devisen.
Aber es gibt keine Stromabschaltungen mehr, die den Kubanern jahrelang das Leben schwer machten. Die
»Energetische Revolution«, die 2005 zaghaft begann, hat Erfolg. Vor allem ziehen Einsparmaßnahmen, die
sich der Staat Abermillionen kosten lässt. Zehn Millionen Glühlampen wurden unentgeltlich gegen Sparlampen
ausgetauscht. Ersetzt wurden 2,2 Millionen stromfressende Kühlschränke, 177 000 Klimaanlagen, zahlreiche
Wasserpumpen – alles zahlbar in nationaler Währung zu einem Drittel des Devisenpreises, mit bis zu
25-jährigen Kreditlaufzeiten. 150 000 Leitungsmasten, tausende Generatoren, 20 000 Transformatoren wurden
erneuert. Und die Aktion ist noch nicht beendet.
Kuba und Venezuela tragen dafür die Hauptlast in Höhe von zwei Milliarden Dollar. Auch China ist
beteiligt. 2007 unterzeichnete Kuba mit diesen beiden Partnern Verträge, die Verbesserungen auf allen
Gebieten der Volkswirtschaft vorsehen, die aber, um spürbar zu werden, ihre Zeit brauchen.
Beispiel Bustransport: Aus China sollen tausende Fahrzeuge importiert werden. Doch zunächst müssen die
Straßen, auf denen sie verkehren, befahrbar, also repariert sein. Chauffeure müssen lernen, mit moderner
Technik umzugehen. Und die des pfleglichen Umgangs entwöhnten Passagiere müssen »soziale Disziplin« üben,
wie es im Behördenjargon heißt.
Venezuela und Kuba, die vor sechs Jahren mit einem Handels- und Warenaustausch in Höhe von 32 Millionen
Dollar begannen und heute bei sieben Milliarden liegen, haben auch den Bau von 55 Fabriken und Werkstätten
zur Herstellung pharmazeutischer und polygrafischer Produkte, Plasteerzeugnissen sowie von
Lederverpackungsmaterial, Möbeln, Autobatterien, reinem Alkohol und anderem vereinbart. 2007 wurden zum
dritten Mal hintereinander vier Millionen Tonnen eigenes Erdöl gefördert und 32 neue Bohrungen
niedergebracht.
Weiter hinkt der Wohnungsbau den Plänen hinterher, und auch die Landwirtschaft liegt im Argen. In den
öffentlichen Debatten wurde vorgeschlagen, den nicht kultivierten staatlichen Boden – das sind 50 Prozent
– Genossenschaften zu übertragen. Und so wird es wohl kommen.
Was die Beziehungen zu den USA betrifft, so wird sich nichts ändern, solange dort Präsident George Bush
am Ruder ist. Auch danach werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Auf keinen Fall ist eine
Normalisierung in Sicht, trotz aller möglichen kubanischen Reformen. Denn Washington will kein
reformiertes Kuba, sondern ein Kuba, das kapituliert. Die kubanische Regierung hegt aus Erfahrung keine
Illusionen.
Das Jahr 2007 war vor allem ein Jahr des Nachdenkens, des überdenkens. Die Krise, die »Sonderperiode in
Zeiten des Friedens«, die Kuba aus den Angeln zu heben drohte, ist noch nicht endgültig aus der Welt. Aber
heute kann jeder Kubaner laut sagen, dass der 89-Milliarden-Schaden, den die Blockade dem Land zugefügt
hat, nicht die Ursache aller Schwachstellen der Revolution ist.
 Leo Burghardt, Havanna
Leo Burghardt, Havanna
Neues Deutschland 02.01.2008
|








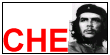


|

