|
|
Kuba ist nicht allein
Nach seinem Rücktritt befindet sich Fidel Castro an der Spitze der vierten Gewalt
In einem von der Tageszeitung Granma am 19. Februar in Havanna veröffentlichten Brief kündigte Fidel
Castro das Ende seiner langen und außergewöhnlichen politischen Laufbahn an – indem er den Verzicht
auf eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt erklärte.
Er bleibt, zumindest vorerst, Erster Vorsitzender der Kommunistischen Partei Kubas – keine geringe
Funktion in einem politischen System mit einer Einheitspartei. Seinen Rücktritt von der Parteispitze
könnte er eigentlich nur auf einem Kongreß der PCC erklären – doch seit 1997 ist die Partei nicht
mehr zu einem Kongreß zusammengekommen.
In jedem Fall bleibt sein bedeutender Einfluß auf die öffentliche Meinung in Kuba bestehen. Er wird
weiter kämpfen – wenn auch nun an anderer Front. In seinem Brief hat er erklärt, er würde sich jetzt der
»vierten Gewalt« widmen, d.h. er wird weiter für die Granma, die Tageszeitung mit der größten
Auflage der Insel und »das Zentralorgan der Partei«, schreiben. Er kämpft wie zuvor um Ideen, nun
ausschließlich an der Front der kulturellen Hegemonie, wie Gramsci sagen würde.
In der heutigen Welt hat die vierte Gewalt manchmal mehr Macht als die erste. Und Fidel Castro hat
klargemacht, daß er weiter Artikel verfassen wird, wie schon während der langen Zeit seiner
Rekonvaleszenz. Lediglich der Namen der Rubrik ändert sich: Statt »Überlegungen des Comandante en Jefe«
sind sie nun mit »Überlegungen des Genossen Fidel« überschrieben – außerdem hat er gebeten, seine
Artikel nicht mehr auf dem Titelblatt der Granma, sondern diskreter auf Seite zwei erscheinen zu lassen.
Wir können wetten, daß die Kubaner genauso wie internationale Beobachter sie weiter mit
größter Aufmerksamkeit lesen werden, denn niemand kann Fidel Castro als ideologischen Anführer der
Revolution ersetzen.
Sein Weg ist einzigartig in der Geschichte seines Landes, nicht nur aufgrund seiner Führungsqualitäten,
sondern auch weil es die historischen Umstände, die ihn geformt haben, nicht noch einmal geben wird. Fidel
Castro hat alles erlebt: die Guerilla in der Sierra Maestra, die Revolution von 1959, die bewaffneten
Angriffe der Vereinigten Staaten, die Raketenkrise im Oktober 1962, die Unterstützung anderer Guerillas
(darunter die von Che Guevara in Bolivien), das Verschwinden der UdSSR und Dutzende Auseinandersetzungen
mit dem Nachbarn im Norden.
Die Tatsache, daß er die Regierungsgewalt noch zu Lebzeiten abgibt, dürfte eine friedliche Evolution
in Kuba erlauben. Die Mehrheit der Kubaner ist einverstanden, daß ihr Land von einer anderen
Mannschaft, doch auf dieselbe Weise und mit demselben sozialistischen Weg regiert wird. Immerhin hält Raúl
Castro die Zügel der Regierung seit mehr als anderthalb Jahren in der Hand, und das Leben geht – ohne
große Sprünge – seinen normalen Gang. Mit Pragmatismus hat er die Fragen ins Zentrum seines Handelns
gestellt, die die Leute beschäftigen: die Ernährung, das Transport- und Wohnungswesen, die
Lebenshaltungskosten.
Die Bürger haben Zeit gehabt, um sich an die Vorstellung zu gewöhnen, daß Fidel Castro nicht mehr
die Regierung lenken würde. In seinen Artikeln jüngeren Datums hat er mit pädagogischem Geschick
tröpfchenweise, eindeutige Informationen durchsickern lassen, die seine jetzt getroffene Entscheidung
vorwegnahmen. So hat er im Dezember 2007 gewarnt: »Meine elementare Aufgabe ist es, nicht mich an
Ämter zu klammern, und noch viel weniger, jüngeren Menschen den Weg zu versperren, sondern
Erfahrungen und Ideen beizusteuern, deren bescheidener Wert aus der außergewöhnlichen Zeit stammt,
die ich erleben durfte.«
Castro ist eine Persönlichkeit mit rigorosen ethischen und moralischen Prinzipien und einer strengen wie
bescheidenen Lebensweise. Oft wird vergessen, daß er sich leidenschaftlich für Umweltfragen und
Ökologie einsetzt. Weder ist er das Ungeheuer, als das ihn einige Medien des Westens beschrieben
haben, noch der Superman, wie er in manchen kubanischen Medien dargestellt wird. Mit seinem unglaublichen
Stehvermögen ist er vor allem ein Ausnahmestratege, ein Anführer, der im Angesicht der feindlichen
nordamerikanischen Großmacht sein ganzes Leben dem Widerstand gewidmet hat. Nie hat er nachgegeben,
nie wurde er besiegt. Das ist sein großer Triumph.
Fidel Castro ist eine merkwürdige Mischung aus Idealismus und Pragmatismus. Er träumt von einer
vollkommenen Gesellschaft, obwohl er weiß, daß die materiellen Bedingungen äußerst
schwer zu verändern sind. Er gibt sein Präsidentenamt auf, überzeugt von der Stabilität des politischen
Systems in Kuba. Er gibt den Stab an ein erfahrenes Team weiter – eine Ablösung, die zu keinen
spektakulären Reformen führen wird. Die Mehrheit der Kubaner, sogar die, die einige Aspekte des Systems
offen kritisieren – Einschränkung von Freiheiten und politischen Rechten –, ziehen – trotz Washington –
eine Veränderung radikalen Zuschnitts weder in Betracht, noch wünschen sie diese. Sie wollen einige der
Vorteile, die der Sozialismus ihnen gebracht hat, nicht verlieren: kostenlose Bildung, umfassende
medizinische Versorgung, Vollbeschäftigung, kostenloses Wohnen. Wasser, Strom und Telefon fast zum
Nulltarif; und eine ruhiges und sicheres Leben in einem friedlichen Land mit niedrigen Verbrechensraten.
Zweifellos wird sich der kubanische Sozialismus weiterentwickeln – jeder Personalwechsel zieht einen
Wechsel der Methoden nach sich. Wird Raúl es so wie China oder wie Vietnam machen? Wahrscheinlich weder
noch. Kuba wird seinem eigenen Weg folgen. Die neue Regierung wird sicherlich Veränderungen im
wirtschaftlichen Bereich einführen, doch es ist wenig wahrscheinlich, daß wir eine »kubanische
Perestroika« erleben, eine »politische öffnung« oder Wahl mit mehreren Parteien. Die Regierung ist
überzeugt, daß so eine Art des »Übergangs« das Tor für eine Einmischung der USA und einer mehr
oder weniger verdeckten Form der Annexion öffnen würde. Sie halten den Sozialismus für die bessere Wahl,
auch wenn er perfektioniert werden kann – und muß.
Die Hauptaufgabe besteht darin, es mit der ewigen Herausforderung durch die Vereinigten Staaten
aufzunehmen. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat Raúl Castro öffentlich erklärt, daß er
bereit sei, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen, um mit Washington über alle zwischen den beiden
Ländern existierenden Konflikte zu reden. Wahrscheinlich sind es die USA, von denen die wichtigsten
politischen Signale für eine Evolution Kubas ausgehen können. Der im Augenblick vorne liegende
demokratische Präsidentschaftsanwärter, Barack Obama, hat bereits 2003, als er für den US-Senat
kandidierte, dafür plädiert, das Wirtschaftsembargo aufzuheben und gefordert, die Beschränkungen für das
Reisen nach Kuba und das Senden von Geld aufzuheben. Vor kurzem hat er die Absicht verkündet, das Gespräch
mit allen Staaten zu suchen, die von den Vereinigten Staaten als »Feinde« oder »Gegenspieler« angesehen
werden – also auch mit Kuba. Am 22. Februar hat Obama eine notwendige »Transition« in den Vereinigten
Staaten selbst gefordert– zumindest in dieser Frage: Wenn es Zeichen des Wandels auf der Insel gebe,
müßten, erklärte er, »die USA vorbereitet sein, um zu einer Normalisierung der Beziehungen zu
gelangen und das Embargo abzumildern«. Das würde eine kopernikanische Wende in der US-Außenpolitik
seit 1961 einläuten.
Nach den Worten von Fidel Castro ist George W. Bush für Kuba, aber auch für das nordamerikanische Volk
und den Rest der Welt der schlimmste der zehn US-Präsidenten gewesen, mit denen er es zu tun hatte. Der
Abgang Bushs in einem Jahr müßte Washington – angeschlagen durch die furchtbaren Lektionen im Irak
und dem Nahen Osten – zu einer Revision seiner Außenpolitik bringen und zweifellos auch dazu, sich
wieder in Richtung Lateinamerika zu orientieren. Die Vereinigten Staaten werden auf eine völlig andere
Situation stoßen als die, die sie selbst in den Jahren von 1960 bis 1990 gestaltet haben. Kuba ist
nicht mehr allein. Außenpolitisch haben die Kubaner ihre Bindungen zu allen lateinamerikanischen
Staaten gestärkt. Zum ersten Mal sind Havannas Freunde wirklich an der Macht, vor allem in Venezuela, aber
auch in Brasilien, in Argentinien, in Uruguay, in Nicaragua, in Panama, in Haiti, in Ecuador und in
Bolivien. Es wird deshalb im Interesse Washingtons liegen, die Beziehungen mit jedem einzelnen von ihnen
neu zu definieren. Kuba hat den Austausch insbesondere mit den Ländern, die in der ALBA (»Bolivarische
Alternative für die Amerikas«) zusammengeschlossen sind, intensiviert sowie Partnerschaftsabkommen mit den
Staaten des Mercosur unterzeichnet.
Während auf Kuba, der zuletzt erwartbare Rückzug von Fidel Castro nichts am Gang der Revolution ändert,
könnte eine mögliche Wahl von Barack Obama in den Vereinigten Staaten in der Evolution Kubas vielleicht
einen kleines Erdbeben auslösen.
* Ignacio Ramonet ist Direktor von "Le Monde diplomatique" und Ehrenpräsident von ATTAC. Er
war Referent auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt und hat ein Buch mit Gesprächen mit Fidel
Castro verfaßt, das bislang noch nicht auf deutsch erschienen ist: »Fidel Castro, biografía a dos
voces«, Editorial Debate, Madrid, 2007 (erweiterte und durchgesehene Ausgabe)
 übersetzung: Timo Berger
übersetzung: Timo Berger
Junge Welt, 12.03.2008
|








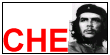


|

