|
|
Lektionen einer Guerilla
Reflexionen über Gewalt und Revolution. Fidel Castro im Gespräch mit Ignacio Ramonet
Am 8. Januar 1959 zieht Fidel Castro siegreich in Havanna ein. Am selben Tag wird die Revolutionäre
Regierung, unter dem Vorsitz des Richters Manuel Urrutia und dem Anwalt José Miró Cardona
als Premierminister, installiert. Fidel Castro übernimmt den Posten des Comandante en Jefe, des
Oberbefehlshabers über die Revolutionären Streitkräfte. Die Ereignisse dieses Tages
markieren den Sieg der Guerilla über das reaktionäre Regime des Diktators Fulgencio Batista.
Aus Anlaß des 50. Jahrestages der kubanischen Revolution veröffentlichen wir Kapitel neun aus
den Erinnerungen Fidel Castros, einem fast 700seitigen Interview mit dem spanisch-französischen
Publizisten Ignacio Ramonet, das im Herbst 2008 erschienen ist. Im folgenden Textauszug zieht Castro eine
Bilanz des Krieges und reflektiert über revolutionäre Moral, das Verhalten gegenüber den
Gefangenen und Kriegsjustiz im Guerillakampf in der Sierra Maestra. Wir danken dem Rotbuch Verlag, Berlin,
für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck.
Glauben Sie, daß Sie diesen Krieg aufgrund Ihrer militärischen Taktik oder eher aufgrund
Ihrer politischen Strategie gewonnen haben?
Beides. Schon vor meiner Haft hatte ich den Plan für den Krieg in der Sierra Maestra, den ganzen
Plan. Wir führten, wie gesagt, einen Bewegungskrieg, Angriff und Rückzug. Überraschung.
Angreifen und wieder angreifen. Und wir haben psychologisch gekämpft. Zuckerrohr verbrannt, um
Batista gegen uns aufzubringen, um ihn zu zwingen, sich zu bewegen und seine Truppen zu verteilen, ihm
die Unterstützung durch Ressourcen und Großgrundbesitzer zu entziehen. Sabotage der
Kommunikations- und Transportwege. Die Guerilla funktionierte für uns wie eine Art Zeitzünder
für einen Prozeß, dessen Ziel die revolutionäre Machtübernahme war. Mit einem
Kulminationspunkt: einem revolutionären Generalstreik und dem Aufstand des ganzen Volkes.
Warum haben Sie den irregulären Krieg gewählt?
Ich habe immer an die Möglichkeiten eines irregulären Krieges geglaubt. Die ganze Geschichte
hindurch, schon in den Zeiten Alexanders des Großen und Hannibals haben immer diejenigen gesiegt,
die die Kunst beherrschten, ihre Manöver geheimzuhalten und den Überraschungseffekt, was Waffen,
Truppen, Gelände und Taktik angeht, auszuspielen. Wie oft haben diese Strategen Wind oder Sonne
gegen ihre Feinde eingesetzt! Wer seine eigenen Mittel und in einigen Fällen sogar die Natur am
besten einzusetzen wußte, der trug am Ende den Sieg davon.
Wir brachten all unsere Vorstellungskraft auf, sahen uns gezwungen, Ideen zu entwickeln, mit denen wir in
der Lage wären, das unermeßliche Hindernis zu überwinden, das es bedeutete, eine Regierung
zu stürzen, die auf eine Armee von 8o.ooo schwer bewaffneten Soldaten zählen konnte. Wir hatten
sehr geringe Ressourcen und mußten deren Anwendung optimieren. Das betraf vor allem die Waffen und
die Männer und war gleichzeitig unser größtes Problem.
Schließlich entwickelten wir aber schnell die Kunst, unter unseren Widersachern Verwirrung zu
stiften und sie somit zu zwingen, das zu tun, was wir wollten, daß sie es tun. Ich würde sagen,
wir brachten eine Methode hervor, die feindlichen Truppen zu provozieren und sie zu zwingen, sich zu
bewegen, aufgrund des Prinzips, das wir nach und nach entdeckten und das ich Ihnen bereits geschildert
habe: Der Gegner war zwar stark in seinen Stützpunkten, aber schwach bei Manövern seiner
Truppen. Wir zwangen den Feind, loszumarschieren, um ihn dann an seiner schwächsten Stelle
anzugreifen.
Man muß begreifen, daß eine Kolonne von 400 Mann in einem Wald nur im Gänsemarsch
vorankommt. An einigen Stellen läßt das Gelände es nur zu, daß man einzeln
hintereinander hergeht, und die Schlagkraft eines Bataillons, das im Gänsemarsch daherkommt, ist
minimal, da es sich nicht ausbreiten kann. Wir erledigten ihre Vorhut, griffen ihr Zentrum an und lagen
anschließend dort auf der Lauer, wo die Nachhut sich zurückziehen wollte. Es waren immer
Überraschungsangriffe, und die Angriffsorte hatten wir selbst bestimmt. So wurden wir mit dieser
Taktik ziemlich effizient.
Sie entwickelten die Kunst des Hinterhaltes.
Nun, der Hinterhalt ist so alt wie die Kriege. Wir diversifizierten die Art der Hinterhalte. Der erste
richtete sich immer gegen die Vorhut. Der Verlust derselben führt oft dazu, daß die gesamte
feindliche Kolonne sich zurückzieht. Danach griffen wir sie von der Flanke an, und zum Schluß,
wenn sie sich zurückzogen, lauerten wir ihrer Nachhut auf, wenn die demoralisierte Truppe versuchte,
sich zurückzuziehen, und die Nachhut dabei zur Vorhut wurde.
Du greifst auf einem bestimmten Weg in der Nacht an, zwei- oder dreimal, dann wird der Feind nachts nicht
mehr rausgehen. Du greifst sie bei Tag an – zu Fuß, wenn sie zu Fuß gehen. Wenn sie ihre Leute
auf einen Lastwagen packen, dann greifst du an, wenn sie einen Berg hinauffahren müssen oder aufgrund
eines unwegsamen Geländes in den Bergen sehr langsam fahren; du greifst sie mit automatischen Waffen
an, wenn du kannst und welche hast, oder eben mit anderen. Wenn sie gepanzerte Fahrzeuge benutzen, dann
setzt du Minen ein. Wenn du sie mit deinen Taktiken nicht mehr überraschen kannst, mußt du dir
wieder neue einfallen lassen.
Du mußt immer einen Schritt voraus sein. Überraschen und nochmals überraschen. Dort
angreifen, wo sie nicht damit rechnen, und so angreifen, wie sie es sich nicht vorstellen können.
Wenn sie sich nicht bewegen, umzingelst du einen ihrer Stützpunkte. In diesem Fall wartet die
festgesetzte Einheit immer auf Verstärkung. Wenn keine Verstärkung kommt, gibt sie auf. Sie
wußten mit der Zeit, daß die revolutionären Gruppen das Leben und die Unversehrtheit der
Gefangenen respektierten.
Aber für Sie war das Militärische dem Politischen untergeordnet, denke ich. War die
militärische Strategie das Wichtigste?
Wenn die politische Front, die Einheit aller Anti-Batista-Kräfte, die wir erreichen wollten, gleich
zu Beginn zustande gekommen wäre, dann wäre das Regime von allein gestürzt, vielleicht ohne
daß ein weiterer Tropfen Blut hätte fließen müssen. Das waren unsere Vorstellungen
und Taktiken. Wir sprechen über taktisches Verhalten und darüber, wie man einen Krieg gewinnt.
Unser taktisches Verhalten war sowohl politisch als auch militärisch in der Situation, in der sich
Kuba befand, mehr als korrekt. Deshalb habe ich immer gesagt, daß man die eine Politik
gegenüber der Bevölkerung anwenden muß und eine andere Politik auf den Gegner. Ansonsten
werden Sie niemals siegen. Sie dürfen keine unschuldigen Menschen töten, sondern müssen
gegen die Truppen des Feindes im Gefecht kämpfen. Es gibt keine andere Rechtfertigung für die
Anwendung von Gewalt. Das ist meine Auffassung.
Sie haben einen informellen Krieg geführt, aber dennoch beschlossen, die Gesetze des Krieges
zu respektieren?
Ja. Denn das ist ein entscheidender psychologischer Faktor. Wenn der Feind seinen Gegner bewundert und
respektiert, dann hat man einen großen psychologischen Sieg errungen. Er bewundert dich, weil du es
geschafft hast, ihn zu schlagen, weil du ihm harte Schläge zugefügt hast, und außerdem,
weil du ihn respektierst. Weil du keinen der gefangenen Soldaten geschlagen hast, weil du ihn nicht
erniedrigt und beleidigt, und vor allem, weil du ihn nicht ermordet hast. Es kam der Augenblick, wo
unsere Gegner zu uns aufschauten und uns respektierten. Sie wußten, wie Kriege normalerweise waren
und wie unbarmherzig in aller Welt mit den Besiegten umgegangen wurde.
Haben Sie aus dem Respekt für die Gefangenen ein Prinzip gemacht?
Und gegen die Folter. Denn was uns inspiriert hatte, den Kampf gegen das Regime aufzunehmen, war die
Tatsache, daß es folterte und mordete. Ich habe denen, die uns Menschenrechtsverletzungen vorwerfen,
einmal gesagt: »Zeigen Sie mir einen einzigen Fall außergerichtlicher Tötung oder einen
einzigen Fall von Folter in unserem Land.«
Seit dem Beginn der Revolution?
Seit dem Triumph der Revolution und vorher, seit wir den Kampf in der Moncada begannen, oder dann, als
wir 1956 an Land gingen. Ich kann mich daran erinnern, daß im Kampf gegen bandidos, gemeint sind
konterrevolutionäre Gruppen, in den 60er Jahren einmal einer unserer Anführer Methoden zur
Abschreckung angewendet hat, indem er einige Gefangene in ein Becken getaucht und andere in einen
Hubschrauber verfrachtet hat. Zwar nicht mit der Absicht, sie hinauszuwerfen, aber er wollte sie damit
einschüchtern. Als mir das zu Ohren kam, bin ich sofort ins Escambray-Gebirge gefahren, wo diese
Dinge passiert waren. Diese Leute wurden aufs schärfste zurechtgewiesen. Sie haben nicht physisch
gefoltert, aber es war eine Art psychologische Folter, die sie angewendet haben. Dieses Verhalten war
völlig inakzeptabel.
Außerdem entwickelt sich eine Polizei oder ein Geheimdienst, der foltert, nicht weiter. Sie
entwickeln keine Methoden, wie wir sie entwickelt haben, speziell für die Infiltration und die Suche
nach Beweisen. Wenn Leute verhaftet wurden, dann erinnerten sie sich nicht, wo sie an einem bestimmten Tag
gewesen waren; unsere Sicherheitsorgane wußten es, denn sie hatten es notiert. Wenn Sie gefragt
werden: »Was haben Sie zu der und der Stunde, an jenem Tag im Mai letzten Jahres gemacht?«, dann
können Sie sich nicht erinnern, und den Gefangenen ging es genauso. »Mit wem haben Sie sich
getroffen? Wer hat Ihnen die Waffen beschafft?« Bei uns wurden die Leute dann verhaftet, wenn es
unumstößliche Beweise gab. Das Infiltrieren, das Eindringen, funktionierte sehr gut, niemals
aber wurde physische Gewalt angewendet.
Waren Sie die erste Guerilla, die es sich zum Prinzip gemacht hatte, die Bauern nicht zu bestehlen,
keine Frauen zu vergewaltigen und Gefangene nicht zu foltern?
Nein, nein. Das kann man auf keinen Fall sagen, denn ich glaube nicht, daß die Vietnamesen, die
ihren Krieg im Jahr 1946, also vor unserem, begonnen hatten, oder die Algerier, die im Jahr 1954, also
auch vor uns, gekämpft hatten, Frauen vergewaltigt oder Bauern bestohlen haben. Das glaube ich nicht.
Es hat viele Kämpfe gegeben, wo diese Prinzipien respektiert wurden, und ich habe keine Beweise
für das Gegenteil.
Die Widerständler gegen die deutschen Soldaten hinter der sowjetisch-deutschen Front – ich glaube
nicht, daß sie gefoltert oder Frauen vergewaltigt haben. Diejenigen, die rauben, morden,
vergewaltigen und brandschatzen, sind in aller Regel die Armeen der reaktionären, diktatorischen
Regime, gegen die Revolutionäre kämpfen, obwohl niemand weiß, was auf den Schlachtfeldern
des Zweiten Weltkrieges alles passiert ist. Ich kann mir vorstellen, daß es Fälle gab, wo man
sich gegenseitig erschoß, denn die Truppen der Nazis hatten sicherlich kein Mitleid mit einem
Bolschewiken. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Leute aus dem sowjetischen Widerstand die Nazis
behandelten, wenn sie einen gefangengenommen hatten. Sie konnten es vielleicht nicht so machen wie wir,
denn wenn sie einen dieser Faschisten freigelassen hätten, hätte dieser am nächsten Tag
wieder sowjetische Männer, Frauen und Kinder ermordet. In solchen Fällen hätte ich ihnen
recht gegeben, wenn sie jemanden auf diese Art aus dem Verkehr ziehen.
In Mexiko gab es 1910 eine starke Revolution, die viele Jahre andauerte. In Spanien gab es 1936 auch einen
blutigen Bürgerkrieg.
Wo auf beiden Seiten Greueltaten begangen wurden.
In Spanien hat es sogar Kriege hinter der Front gegeben, was Hemingway zu seinem Roman »Wem die Stunde
schlägt« (1) inspiriert hat. Die Geschichten über die Geschehnisse hinter der Front
während des Spanischen Bürgerkrieges waren sehr nützlich für uns. Zu erfahren, wie es
die republikanischen Guerillakrieger schafften, sich hinter der Front der franquistischen Armee deren
Waffen zu bemächtigen. Mir hat dieses Buch dabei geholfen, mein Konzept des irregulären Kampfes
in Kuba herauszuschälen.
Der Roman von Hemingway?
Ja, denn ich habe mich häufig an dieses Buch erinnert. Eines Tages, wenn wir davon sprechen,
erzähle ich Ihnen mehr.
Warum erzählen Sie es mir nicht jetzt?
Nun gut, wenn Sie möchten. Ich habe das Buch »Wem die Stunde schlägt« zum ersten Mal
während meines Studiums gelesen. Und später muß ich es noch mehr als dreimal wiedergelesen
haben. Ich kenne auch den Film, den man dann gedreht hat. Mich interessierte dieser Roman, denn es geht
darin unter anderem um den Kampf hinter den Fronten einer konventionellen Armee. Es erzählt vom Leben
hinter der Front und von der Existenz einer Guerilla, die in einem Territorium operiert, das offensichtlich
vom Feind besetzt ist. Ich spreche von den detaillierten Beschreibungen Hemingways in diesem Roman.
Wir hatten eine vage Vorstellung davon, wie ein irregulärer Krieg vom militärischen und
politischen Standpunkt her geführt werden könnte, aber »Wem die Stunde schlägt« vermittelt
konkrete Erfahrungen. Denn Hemingways Erzählungen sind immer sehr realistisch, von großer
Klarheit und Präzision. Alles wirkt echt und überzeugend. Es fällt einem schwer, das
Gelesene wieder zu vergessen, denn man hat das Gefühl, es selbst erlebt zu haben. Er schafft es,
daß sich der Leser auf den Schauplatz des grausamen Spanischen Bürgerkrieges versetzt
fühlt. Später haben wir das Leben dieser Guerillakämpfer in der Sierra Maestra am eigenen
Leib erfahren, und das Buch wurde zu etwas Vertrautem. Wir kehrten immer zu ihm zurück, um uns zu
inspirieren – auch als wir schon in der Guerilla kämpften. Natürlich haben wir viele andere
Texte über reale oder erfundene Geschichten gelesen, die dieses Thema behandeln. Und wir versuchten
unter den besonderen Bedingungen in unserem Land, eine Ethik in unseren Krieg einzubringen.
Ich wiederhole es: Man kann nicht behaupten, daß wir die einzige mit einer Ethik versehene Guerilla
gewesen wären.
Sie haben aber aus dieser Ethik ein fundamentales Prinzip gemacht.
Ohne diese Philosophie hätten die Kämpfer möglicherweise auf Teufel komm raus Gefangene
erschossen und viele andere Dinge getan. Der Haß auf die Ungerechtigkeit und Verbrechen war immens.
Haben Sie terroristische Anschläge oder Attentate gegen Batistas Truppen verübt?
Weder Terrorismus noch Attentate und auch keine Morde an hochgestellten Persönlichkeiten. Sie wissen,
daß wir Gegner Batistas waren, aber wir haben nie ein Attentat gegen ihn verübt, obwohl wir es
hätten tun können. Er war verletzlich. Viel schwieriger war es, in den Bergen gegen seine Armee
zu kämpfen oder zu versuchen, eine Festung einzunehmen, die von einem Regiment verteidigt wurde. Wie
stark war die Besetzung in der Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953? Um die tausend Mann, vielleicht sogar
mehr.
Ein Attentat auf Batista wäre um ein Vielfaches leichter gewesen, aber wir haben es nie verübt.
Hat der Tyrannenmord irgendwann in der Geschichte einmal zu einer Revolution verholfen? Nichts würde
sich verändern an den objektiven Bedingungen, die eine Tyrannei hervorbringen.
Die Männer, die die Moncada-Kaserne angegriffen haben, hätten Batista auf seiner Farm ermorden
können, auf der Straße, wie es im Fall Trujillos (2) passierte, oder irgendwo sonst. Aber wir
hatten eine klare Vorstellung: Der Mord an einem Diktator löst das Problem nicht. Die reaktionären
Kräfte ernennen einen anderen Tyrannen an seiner Stelle, und der Getötete wird in den eigenen
Reihen zum Märtyrer erhoben. Die Unzweckmäßigkeit eines solchen Mordes war im Lauf der
Geschichte schon von anderen Revolutionären erkannt worden.
Innerhalb der Kommunistischen Internationalen wurde auch viel darüber diskutiert, ob es korrekt sei,
durch Banküberfälle Geld zu sammeln. In der Geschichte der Sowjetunion beschuldigen einige
Stalin, solche Banküberfälle vorgenommen zu haben. Das stand in völligem Widerspruch zum
gesunden Menschenverstand. Sowohl die Theorie des Tyrannenmordes als auch die Idee, Banken zu
überfallen, um Geld zu sammeln. Letzteres war in der kubanischen Gesellschaft bürgerlichen
Charakters vollends geächtet. Die Banken wurden als Institutionen sehr respektiert. Das hat gar
nichts mit einer bestimmten Moral zu tun, sondern mit einer ganz praktischen Frage: Unterstützt du
den Feind oder die Revolution?
Und die Theorie des Attentates, das unschuldige Opfer verursachen kann?
Wenn wir vom Krieg sprechen, dann hatten wir dieses Problem nicht, denn unser Krieg dauerte
fünfundzwanzig Monate, und ich kann mich nicht daran erinnern, daß es in all den Kämpfen
unserer Kolonne 1 auch nur ein einziges ziviles Opfer gegeben hätte. Ich müßte die
Anführer der anderen Bataillone befragen, ob sich jemand an einen solchen Fall im Rahmen seiner
Operationen erinnern kann.
Für uns ist es eine Philosophie, daß keine unschuldigen Personen geopfert werden dürfen.
Das war immer unser Prinzip, fast ein Dogma. Es gab einige Fälle, wo Untergrundkämpfer Bomben
gelegt haben, was im übrigen eine Tradition in allen revolutionären Kämpfen unseres Landes
war, aber wir wollten das nie, denn wir erklärten uns mit diesen Methoden nicht einverstanden. Wir
sorgten uns immer um die Zivilisten, wenn es zu Kämpfen kam, wo es ein gewisses Risiko gab.
Sie kennen den Fall der Moncada-Kaserne. Ich habe Ihnen unseren Plan erläutert, und es hätte
keine Gefahr für auch nur einen einzigen Zivilisten gegeben. Die einzigen Zivilen, für die ein
Risiko bestand, waren wir, die bewaffneten Revolutionäre.
Es scheint, als hätten Sie die Parole ausgegeben, nach Möglichkeit auch Tote in den Reihen
Batistas zu verhindern. Ist das richtig?
Über die feindlichen Soldaten, die im Kampf starben, machten wir uns keine großen Sorgen. Aber
über diejenigen, die sich ergaben oder in irgendeinem Kampf gefangengenommen wurden, schon. Wenn Sie
das nicht tun, werden Sie nicht siegen. Im Krieg wie in der Politik gibt es elementare Prinzipien. Es ging
hier nicht um ein frommes Verhalten. Die Ethik ist nicht einfach eine moralische Sache; wenn sie
wahrhaftig ist, dann trägt sie auch Früchte.
Heute versuchen gewalttätige Gruppen in aller Welt, über terroristische Anschläge
politische Ziele zu erreichen. Mißbilligen Sie diese Methoden?
Auf der Grundlage terroristischer Anschläge gewinnt man keinen Krieg, so einfach ist das. Denn solche
Aktionen bringen Widerstand, Feindseligkeit und Ablehnung all derer hervor, die man zweifellos
benötigt, um den Krieg zu gewinnen.
Deshalb hatten wir die Unterstützung von neunzig Prozent der Bevölkerung. Glauben Sie, wir
hätten das erreicht, wenn wir unschuldige Menschen geopfert hätten? Glauben Sie, wir hätten
das mit Bomben erreicht oder mit der Ermordung von Zivilisten und gefangenen Soldaten? Hätten wir
damit die Waffen bekommen, die wir erbeutet hatten? Wie viele Menschenleben hingegen haben wir gerettet!
Ich habe Ihnen erzählt, was im Kampf in Uvero passierte, als wir eine Garnison am Ufer des Meeres
angriffen. Nicht nur eine sehr gefährliche Aktion, sondern auch einer der härtesten Kämpfe,
die wir je geführt haben und in dem ein Drittel unserer Kämpfer starb oder verletzt wurde. Wir
haben die verletzten Soldaten unserer Gegner medizinisch behandelt und zurückgelassen, damit die
Armee sie abholen konnte, und nur einige Unverletzte gefangengenommen, die nicht gleich freigesetzt wurden.
Vom ersten Kampf an haben wir unsere Medikamente unterschiedslos für alle Verletzten eingesetzt,
sowohl für unsere als auch die der Armee. Im ersten Kampf waren wir nur neunzehn Männer gegen
eine gemischte Besatzung aus Soldaten und Marinesoldaten und konnten unseren ersten Sieg verzeichnen.
Davon habe ich schon berichtet. Am Ende des Kampfes waren mehrere feindliche Soldaten tot, und von den
übrigen war nur einer unverletzt. Wir hatten keinen einzigen Verlust. Es war 2.40 Uhr morgens, als
wir den Kampf begannen, der aufgrund des heftigen Widerstandes fast eine Stunde dauerte: Sie glaubten, wir
würden sie töten, wenn sie sich ergäben. Als der Kampf beendet war, behandelten wir ihre
Verletzten und ließen die notwendigen Medikamente für deren Versorgung zurück. Einer von
unseren Leuten blieb dort, um sich um sie zu kümmern. Wir nahmen die Waffen und entfernten uns vor
dem Morgengrauen von diesem Ort.
Unsere spärlichen Medikamentenvorräte teilten wir mit den verletzten feindlichen Soldaten.
Manchmal hatten wir nicht einen einzigen Verletzten, aber wenn es Verletzte auf beiden Seiten gab,
kümmerten wir uns um alle. Wenn wir vor der Wahl gestanden hätten, ob wir das Leben eines
unserer Kameraden oder das eines gegnerischen Soldaten retteten, dann hätten wir uns sicherlich
für unseren Kameraden entschieden. Wenn wir aber selbst keinen einzigen Verletzten hatten, dann
überließen wir die Medikamente, die wir hatten, denen, die sie benötigten. Das haben wir
vom ersten bis zum letzten Kampf in unserem Krieg so gehandhabt.
Unser Land hat nicht viel, aber wir würden alles hergeben, wenn sich auch nur ein einziger Fall eines
gefangenen Soldaten findet, der in unserem Befreiungskrieg exekutiert oder mißhandelt wurde.
Diese Ideen – das Warum unseres Kampfes gegen ein sehr repressives Regime, das folterte und mordete –
haben sich mehr als neunundvierzig Jahre gehalten, seit jener Landung der »Granma« am 2. Dezember 1956.
Ich zähle die Jahre bis zum Dezember 2005.
Neunundvierzig Jahre.
Ja, seit neunundvierzig Jahren, seit wir von der »Granma« an Land gingen, haben wir diese Prinzipien
aufrechterhalten: kein Tyrannenmord, keine zivilen Opfer, kein Terrorismus. Warum? Weil uns das niemals in
den Sinn kam.
Vergessen Sie nicht, was ich ihnen erzählt habe: Wir hatten bereits eine marxistisch-leninistische
Bildung, die Einfluß auf unsere Strategien nahm – und ich habe gesagt, was ich dachte. Ein
Tyrannenmord ist nicht notwendig, wenn man begreift, daß er keinen Sinn hat. Ich habe Ihnen auch
erzählt, was ich von diesen Formen der Enteignung von Fonds im besonderen Falle Kubas hielt, mehr aus
praktischen als aus ethischen Gründen. Weder die Theoretiker unserer Unabhängigkeitskriege noch
die des Marxismus-Leninismus haben jemals Attentate oder andere Aktionen gepredigt, durch die unschuldige
Menschen getötet würden; die revolutionäre Doktrin kennt keine solche Waffe.
Etwas anderes sind die Fehler, die man begeht, wenn man an der Macht ist. Ich spreche von unserer eigenen
Geschichte. Ich glaube, wir haben ihr eine neue Seite hinzugefügt, vor allem bezüglich der
Aufrechterhaltung unserer Prinzipien über einen solch langen Zeitraum und obwohl wir harte und
schlimme Episoden erlebt haben.
Wenn umzingelte Bataillone sich ergaben, machten wir den Gefangenen gegenüber folgendes
Zugeständnis: Die Soldaten ließen wir uneingeschränkt frei; denjenigen, die für ihre
Verbrechen bekannt waren – wenn es jemanden gab –‚ boten wir an, nicht die Höchststrafe gegen sie
auszusprechen. Bei den Vereinbarungen mit einem belagerten Bataillon oder welcher Einheit auch immer
überließen wir den Offizieren ihre persönliche Waffe. Die physische Integrität des
Gegners mußte uneingeschränkt respektiert werden. Wenn man sie ermorden will, nachdem sie sich
ergeben haben, werden sie bis zum Tod kämpfen und kosten dich somit mehr Kugeln und mehr
Menschenleben. Um es in zwei Sätzen zu sagen: Du gewinnst den Krieg nicht. Der Gegner wird immer mehr
Waffen, mehr Ressourcen und mehr ausgebildete Männer haben.
Es gab Soldaten, die sich bis zu dreimal ergaben, und dreimal ließen wir sie frei. Schließlich
hatten sie uns ja ihre Waffen überlassen. Sie wurden in eine andere Gegend oder eine andere Provinz
versetzt, aber auch dorthin kamen die Kämpfe. Die feindlichen Soldaten waren unsere Waffenlieferanten,
und die Bauern waren unsere wichtigsten Stützen und unsere Lebensmittellieferanten. Batistas Soldaten
raubten, brannten Häuser nieder und ermordeten Menschen. Die Bauern sahen hingegen, daß wir sie
respektierten. Wir zahlten, was wir konsumierten, und manchmal sogar zu einem höheren Preis; wenn
wir ein Huhn oder Schwein mitnahmen und gerade niemand zu Hause war, hinterließen wir eine Nachricht,
wo wir das Geld deponiert hatten. In keinem noch so kleinen Geschäft, das es gab, hatten wir
irgendwelche Schulden. Das war die Politik gegenüber der Bevölkerung. Anders hätten wir
niemanden für uns gewonnen. Glauben Sie nicht, die Bauern hätten irgendeine Schule für
revolutionäre Instruktionen besucht. Keiner von uns kannte die Sierra. Wie hätten wir ohne sie
diesen Krieg gewinnen können?
Nur mit dieser Politik?
Ohne sie und ohne bestimmte operative Konzepte hätten wir diesen Krieg nicht gewonnen.
Dennoch mußten Sie in der Sierra eine »Revolutionäre Justiz« einführen, die in
manchen Fällen zur Anwendung der Todesstrafe geführt hat, oder?
Nur im Fall von Verrat, und die Anzahl der bestraften Personen war sehr gering. Ich erinnere mich,
daß es innerhalb einer Gruppe von Mitgliedern der Rebellenarmee den Keim eines Banditentums gab,
als wir noch eine kleine Truppe von vielleicht 200 Männern waren, oder eher noch weniger, vielleicht
150. Obwohl wir uns da schon verteidigen und verhindern konnten, zerstört zu werden! Es ging um den
Umgang mit der Bevölkerung, ein sensibles Thema. Wir zahlten den Bauern mit unseren geringen Mitteln
jede Ware, die wir verbrauchten, selbst wenn sie es nicht wollten, und meist noch zu einem besseren Preis.
Wir respektierten – wie gesagt – ihre Felder und ihr Vieh, ihre Familien, Kinder, Frauen. Das war
sprichwörtlich. Während die Armee Batistas mordete, raubte und plünderte.
Für uns war dieses aufkeimende Banditentum innerhalb der Gruppe tödlich, und wir mußten
die Verantwortlichen schlichtweg erschießen. Es wurden Urteile gesprochen über einige, die
Häuser oder Geschäfte brutal überfallen hatten. Und bei dieser Gelegenheit, mitten im Krieg,
wurde die Strafe angewendet. Sie war unumgänglich und wirkungsvoll, denn von diesem Augenblick an hat
nie wieder ein Mitglied der Rebellenarmee ein Geschäft überfallen. So wurde eine Tradition
geschaffen. Wir haben eine revolutionäre Ethik durchgesetzt – einen uneingeschränkten Respekt
vor der Bevölkerung.
1 Ernest Hemingway (1899–1961), US-amerikanischer Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger 1954.
Während des Bürgerkrieges Korrespondent in Spanien (1936–1939). Aufgrund dieser Erfahrung
schrieb er – im Zimmer Nr. 525 des Hotels Ambos Mundos in Havanna – den Roman »For Whom the Bell Tolls«
(Wem die Stunde schlägt), der 1940 veröffentlicht wurde und eines der berühmtesten
literarischen Werke zu diesem Konflikt ist. 1943 drehte der Regisseur Sam Wood in Hollywood einen Film mit
dem gleichen Titel, der auf Hemingways Roman basierte. In den Hauptrollen Gary Cooper und Ingrid Bergman.
2 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891–1961), Diktator der Dominikanischen Republik, wurde am
30.5.1961 bei einem Attentat erschossen; die damit beabsichtigte Beseitigung der Diktatur mißlang
indes – d. Red.
Fidel Castro (mit Ignacio Ramonet): Mein Leben. Aus dem Spanischen von Barbara Köhler, mit einem
umfangreichen Anhang versehen (Anmerkungen, Chronologie, Literaturverzeichnis, Register), Rotbuch Verlag,
Berlin 2008 (2. Auflage), 800 S., geb., 29,90 Euro, ISBN 978-3867890380
 Junge Welt, 08.01.2009
Junge Welt, 08.01.2009
|








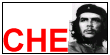


|

