|
|
Erinnerungen für die Zukunft
Wie der Boden der kubanischen Revolution bereitet wurde. Impressionen aus Havanna und Oriente 50 Jahre
nach dem Sieg der Guerilla (Teil 1)
Als der Sozialismus in Europas Osten seinem Ende entgegentaumelte, was niemand so recht ahnte damals, im
Laufe des Jahres 1989, da reiste Gerhard Gundermann auf die »rote Insel der Karibik«. Er selbst, der als
Poet und Liedermacher wie kein anderer den Niedergang seines Landes in Text und Musik faßte, den
Absturz vieler seiner Freunde im neuen System und die unentschiedene, trügerisch-hoffnungsbeladene
Stille in jenem kleinen Zeitfenster dazwischen, begab sich auf die Suche. Nicht so pessimistisch
vielleicht wie die Schwarzseher, von denen es plötzlich so viele gab: von wegen, nee, das geht nicht
mehr lange gut mit dem »socialismo tropical«. Gundermann kommentierte: »Und eine kleine Katze/ blutjung
und ganz allein/ jemand sagt/ laß die geht bald ein.«
So entfernten sich viele von der Revolution, während unsere Freunde drüben in Havanna in der
Spezialperiode landeten, der totalen Mangelwirtschaft. Und als es nichts mehr zu essen gab, kochten sie
aus Kräutern, die vorher niemand für eßbar angesehen hatte, irgendwelche selbstkreierten
Speisen zusammen und luden ihre Nachbarn ein, und sie machten sich gegenseitig Mut, durchzuhalten und den
Sozialismus nicht den Yankees auszuliefern. Und Gundermann sah: »Jenes Haus in Santa Clara / mit dem Bild
von Che Guevara / das alles war noch da / als ich in Kuba war.«
20 Jahre später stehen wir, Che Guevara im Herzen und eine vernünftige Portion Skepsis im Kopf,
auf »José Marti«, wie Havannas Flughafen nach dem Helden des Unabhängigkeitskrieges
(1895–1898) gegen die spanische Fremdherrschaft immer noch heißt; sein Bild hängt überall,
das vom Che auch, und an der großen Mauer nahe der Landebahn steht »Sozialismus oder Tod« auf
spanisch. »Gundi«, wie ihn jene nannten, die ihn mochten, ist schon elf Jahre unter der Erde, die kleine
Katze hat überlebt, bisher, längst nicht mehr blutjung, aber auch nicht mehr allein.
Die »periodo especial« ist nicht offiziell beendet, und wer heute über kubanische Geschichte spricht,
teilt sie nicht nur in die Epochen vor und nach der Revolution ein, sondern auch in die Zeit vor und nach
der Krise 1990, als mit der Sowjetunion über 80 Prozent des Außenhandels wegbrach und
Gorbatschow die Ölpreise erhöhte und Jelzin den Hahn ganz abdrehte und der Zuckerpreis verfiel
und die Massenviehhaltung mangels Energie und Futter kollabierte und Hunderttausende Kühe verendeten
oder mußten notgeschlachtet werden.
CNN wiederholt gerade zum zigsten Mal die jüngste These Washingtons vom neuen Weg zum »Ende der
Tyrannei« auf Kuba. Diesmal also auf die sanfte Tour, Konterrevolution mit menschlichem Antlitz, ohne
Blockade, Embargo, Anschläge, Militärintervention. Barack Obama als Willy Brandt,
Schafsfell-Imperialismus, obwohl: Auch so mancher Kubaner setzt auf den Sympathieträger im
Weißen Haus – an sich kein Wunder angesichts des Ekels, den allein der Gedanke an dessen
Präsidentenvorgänger immer noch erzeugt.
Unvermittelt fällt mir jener Tag vor mehr als drei Jahrzehnten ein, als der Lufthansa-Jumbo selben
Orts einflog, eine Sensation, technisch wie politisch: War die Landebahn lang genug für den
Riesenvogel, und wie würden die USA reagieren darauf, daß ein Flieger aus der BRD Washingtons
Blockade durchbrach? Nun, sie ließen uns tatsächlich mit Sondergenehmigung landen auf New Yorks
Kennedy-Airport. Das Auftanken dauerte vier Stunden, und die Passagiere hatten währenddessen an Bord
zu bleiben, heiß war’s, die Motoren aus, die Aircondition dito, 250 Leute drinnen, Künstler,
Journalisten, Vertreter politischer Organisationen auf Zwischenstopp zu den Weltfestspielen der Jugend und
Studenten, Havanna/Kuba 1978. Und als die Gangway auf »José Marti« angelegt war, stand die
Stewardeß oben und verkündete: »Die Luft in Havanna prickelt wie der Duft von Champagner.«
Nun riecht es nach verbranntem Diesel, und Obama erwägt, daß Exilkubaner, die in den USA leben,
Reisefreiheit erhalten sollen. Busse, Taxen, die berühmten antiquarischen Amischlitten stauen sich
ebenso wie die weniger berühmten Ladas vor dem noch neuen Terminal. 25 Grad abends um halb neun, das
Pfützenwasser vom Tropenregen kurz zuvor dampft in der Dunkelheit vor sich hin. Die Straßen
des Molochs mit seinen zwei- oder zweieinhalb Millionen Bewohnern liegen merkwürdig ruhig da, und der
Minibus rumpelt durch Schlaglöcher, absolviert einen Dauerslalom, um denselben auszuweichen, stoppt
vor Betonschwellen und Eisenbahnschienen und versucht, sie unbeschadet zu überwinden.
Private PKW gibt es wenige, an keinem Straßenrand einer Metropole habe ich weniger parkende Autos
gesehen. Ökonomische Zwänge mit ökologischem Nutzeffekt. Kein Kubaner wird sich auf legalem
Weg einen Neuwagen leisten können – es sei denn, er bekommt ihn von irgendwem im Ausland geschenkt.
Zudem favorisiert das kubanische Verkehrskonzept uneingeschränkt den öffentlichen Nah- und
Fernverkehr. Das ist Programm. Fidel Castro: »In den Vereinigten Staaten übersteigt der tägliche
Benzinkonsum achteinhalb Millionen Barrel. Das ist eine wahrhaft unhaltbare Menge, die zur raschen
Erschöpfung der nachgewiesenen und der vermuteten Ölreserven der Welt beiträgt.« Sein
Alptraum sei die Vorstellung von 1,3 Milliarden Chinesen »mit einer Pro-Kopf-Zahl an Autos wie bei den
US-Amerikanern«.
Einkauf an der Ecke
In der »Marqués Gonzáles«, einer Nebenstraße der »Salvador Allende« in Centro Habana,
befindet sich unsere Privatunterkunft. Senor Orlando nebst Gattin Luisa haben alles zu bieten, was des
Reisenden Herz begehrt: Bett, Dusche, Kühlschrank, ein Espresso oder Café con leche am Morgen.
Nein, an den letzten ernsthaften Stromausfall können sie sich nicht erinnern, meint der Vermieter,
die Wasserversorgung klappe auch weitgehend, die Zeiten hätten sich tatsächlich geändert,
und um die Ecke locken ein Kaufhaus und jede Menge kleiner Geschäfte und Buden. Einige Straßen
weiter auf dem Bauernmarkt präsentiert sich ein kleines Duftparadies aus Blumen, Gemüse und
Obst. Auch Säfte sind im Angebot, ein Tamarindenkonzentrat. Hier kann jedermann, ob Einheimischer
oder Ausländer, so ziemlich alles einkaufen.
Das war vor ein paar Jahren noch anders. Es existierten zwei Währungen, Kubaner kamen nur dann, wenn
sie in Devisenbesitz waren, an den kaufkräftigen konvertiblen Peso (CUC) heran, und Fremde kaum an
den nationalen Peso. Heute kann einheimisches wie ausländisches Geld offiziell getauscht werden. Der
Einkauf von Brötchen, Sandwich mit Schweinefleisch auf der »Salvador Allende« klappt problemlos, und
viele Habaneros haben ihre Libreta dabei, die Lebensmittelkarte, die zum verbilligten Einkauf stark
subventionierter Grundnahrungsmittel berechtigt – eine in den vergangenen Jahren zunehmend in Frage
gestellte und inzwischen vollständig zur Disposition stehende Versorgung. Gleichbehandlung bedeutet
nicht Gleichheit. Zu unterschiedlich stellt sich inzwischen die Sozialstruktur der einheimischen
Bevölkerung dar.
Die Hunderttausenden, die im Tourismus arbeiten, die Angehörigen der weit über zwei Millionen
Menschen, die Kuba in den vergangenen Jahrzehnten verlassen haben und ihren Verwandten und Bekannten Geld
zukommen lassen, und diejenigen, die ihre kleinen oder auch größeren illegalen Geschäfte
betreiben, brauchen keine Libreta. Daß sie nach wie vor drüber verfügen, sorgt bei jenen,
die in nationalen Pesos bezahlt werden, für Unmut, besonders dann, wenn die Reichen ihre auf Karte
kassierten Waren auch noch verscherbeln.
Welches System an die Stelle treten wird? Noch sind die Planspiele nicht beendet, doch fest steht,
daß die Lage kompliziert bleiben wird: Angesichts der relativ niedrigen Produktivität ebenso
wie angesichts der anhaltenden Krise einer per se ungerechten Weltwirtschaftsordnung, deren Handelspreise
durch den Norden diktiert werden, bleiben die Einkommen recht gering. Trotz aller sozialer und kultureller
Errungenschaften, die sich die Revolution vor allem in Sachen Bildung und Gesundheit, aber auch in Sachen
Internationalismus und zwischenmenschliche Solidarität erkämpft hat: Kuba gehört zum
sogenannten Trikont und wird weiter als »Entwicklungsland« nach UN-Kriterien geführt werden – ob im
hektischen Havanna oder in der Provinz 800 Kilometer ostwärts.
Nach Osten
»Oriente«, so hieß bis 1976 der gesamte Landesteil im äußersten Osten, und er wird meist
heute noch so genannt trotz der verwaltungstechnischen Aufteilung in die Provinzen Tunas, Holguín,
Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo. Osten bleibt Osten auf Kuba, nicht »ehemaliger Osten«, und
als wir in die untergehende Sonne Richtung Holguín fliegen, wird es schneller dunkel als in
Havanna. Dem Abendrot entgegen sozusagen, Genossen. Würde alles glatt laufen auf dem Inlandsflug?
Nun, die angekündigte sowjetische Propellermaschine entpuppte sich als Düsenjet. Und 2009 ist
nicht 1961.
1961 im Sommer verpaßte Bodo Uhse, einer der ersten Besucher des nachrevolutionären Kubas aus
der DDR, der mit einem Frachter voller Solidaritätsgüter von Rostock aus über den
großen Teich getuckert war, sein Flugzeug nach Santiago de Cuba. Glück gehabt, wie er am
nächsten Morgen bemerkte. Da erfuhr er, daß der Flieger die reguläre Route zwangsweise
verlassen mußte. Gekapert. Uhse berichtet: »Gestern schossen einige Passagiere, die sich mit dem
Steward verbündet hatten, den bewaffneten Begleiter der Maschine nieder, setzten dem Piloten die
noch rauchende Pistole ins Genick und zwangen ihn, Kurs auf Miami zu nehmen, wo die amerikanischen
Behörden das Flugzeug beschlagnahmten; das zehnte, das sie sich auf diese Weise aneigneten.« Das war
zweieinhalb Jahre nach der Revolution. Und wenige Monate nach den Ereignissen von »Playa Giron« 1961.
Vor 48 Jahren machte die »Schweinebucht«-Invasion weltweit Schlagzeilen, jener Versuch eines
wohlausgerüsteten 1.500köpfigen Söldnerheeres aus Miami, die Revolution mit Waffengewalt zu
vernichten. Unter ihnen ehemalige Offiziere und Folterer der Batista-Diktatur, die Söhne enteigneter
Großgrundbesitzer und Plantagenmillionäre, die bis dahin für Schlagzeilen lediglich in den
Gesellschaftsspalten der Yellowpress durch ihre Auftritte bei Cocktailpartys in Havannas Clubs der Reichen
gesorgt hatten. Auch der im spanischen Bürgerkrieg an der Seite Francos agierende Pfarrer Ismael de
Lugo war dabei, und US-Kriegsschiffe standen in Guantánamo und in der Karibischen See bereit,
einzugreifen.
Am 19. April 1961, nach drei Tagen, an denen über hundert Kubanerinnen und Kubaner ihr Leben im
Widerstand gegen die Konterrevolution verloren, war der – vom Sonnyboy-Präsidenten John F. Kennedy
gebilligte – Spuk vorbei und die Invasoren vernichtend geschlagen. Der Sieg von Playa Giron ging in die
Geschichte ein – auch deswegen, weil die von der CIA entwickelte Konzeption einen »Grundfehler« aufwies,
»der in der Annahme bestand, das kubanische Volk werde mit Hochrufen, mit Blumensträußen und
Kirchengeläut die Herren empfangen« – so Uhse, Schriftsteller, Kommunist, Interbrigadist in Spanien.
Geschichte von Aufständen
Seine Kuba-Reportage »Im Rhythmus der Conga« hatte es auch deswegen in sich, weil er in ihr mit den
damaligen »objektiven« Urteilen der kommunistischen Weltbewegung über den »Abenteurer Castro« einiges
geraderücken konnte – in Sachen Moncada ebenso wie in Sachen bewaffneter Kampf überhaupt. Kubas
Erfolgsgeschichte als »territorio libre de America«, als erste freies Land Amerikas, ist eine Geschichte
von Aufständen.
Von denen erzählt Holguín, Zentrum der gleichnamigen Provinz und Zwischenstation unserer
Erkundungen auf den Spuren der Revolution, nicht viel, so scheint uns. Holguín, mit über
250.000 Einwohnern viertgrößte Stadt der Insel, wirkt auf den ersten Blick
großflächig-konturenlos, auf den zweiten fallen die vielen bunten Sonnenschirme aus Seide auf,
meist getragen von Frauen, und auf den dritten die Statue des polnischen Papstes, die erste auf Kuba
überhaupt. Vor zehn Jahren war er hier, Johannes Paul II., jede Menge Wünsche im
Reisegepäck. Die enteigneten Kirchengüter erhielt er ebensowenig zurück wie die
katholischen Schulen. Auch blieb die Genehmigung für konfessionellen Unterricht aus, doch immerhin
wurde der 25. Dezember Feiertag. Und Fidel spricht heute noch respektvoll von dem Kirchenmann.
In Holguíns frisch restauriertem Regionalmuseum – »Papageienkäfig« heißt das
Gebäude in Anlehnung an die buntfarbig uniformierten Kolonialsoldaten, die hier während des
ersten Befreiungskriegs (1868–1878) eingesperrt waren – können die Knarre von Comandante Camilo
Cienfuegos und der Patronengurt von Comandante Ernesto »Che« Guevara besichtigt werden. Und am Rande
erwähnt Rebecca, die uns führt, daß »auf diesem Stuhl« Fidel Castro gesessen habe, vor
fünf Jahren, als der Comandante en jefe Holguín besuchte, und wir lachen mit Rebecca. Damals
hatte eine fürchterliche Dürre die gesamte Region im Schwitzkasten gehalten, und die Menschen
bauten Zisternen in den Gärten, und Wasserwagen aus ganz Kuba wurden zusammengekarrt, und es dauerte
verflucht lang bis zum ersten Regen.
»Bald ist der Kanal fertiggebaut«, meint Enrique Robier Rodriguey, der die Region wie seine eigene
Westentasche kennt, »ein architektonisches Meisterwerk«. Es unterquert die Berge in Tunneln und zieht sich
über Hügel und durch Täler auf 60 Kilometern zum nächsten geeigneten See, um in
Zukunft zu verhindern, daß je wieder das Wasser ausgeht. Eine Million Provinzeinwohner hängen
davon ab. Und die insgesamt 11 267 000 Einwohner Kubas mehr oder weniger auch – oder doch zumindest die
Biertrinker unter ihnen. In Holguín werden »Cristal«, »Bucanero« und die anderen Biere der Insel
gebraut, die Technologie stammt aus der DDR und hat dessen Ende weitgehend unbeschadet überstanden.
Tourismus pur
Am Pool des Hotels, in dem wir untergekommen sind, fließt mehr Rum als Gerstensaft. Zwei
dickbäuchige Glatzköpfe, Herkunft unbekannt, schenken johlenden Freunden nach, wenig Cola, viel
Anejo, weißer einjähriger Havanna Club, unmäßige Mengen in glühender Sonne.
»Cuba libre« bis zur Bewußtlosigkeit, es riecht nach Aggression, dunkelhäutige Frauen mit
blondgefärbten Haaren versuchen, durch Mitlachen und Mitmachen die wachsende Hemmungslosigkeit der
körpermächtigen wie zahlungskräftigen Gestalten zu dämpfen. Einer trägt
tatsächlich ein T-Shirt, darauf steht »Ich Chef, du nix« – auf deutsch!
Zur Abreise dann geben die Gäste doch Trinkgeld. Zwei konvertible Pesos (CUC) oder fünf oder
mehr; in der hochindustrialisierten Welt des Kapitals ein Klacks, der den Nehmer nicht reich macht. Auf
Kuba doch: Der Animateur, die Putzfrau, der Barkeeper – alle diejenigen, die im Tourismus arbeiten,
streichen für die Arbeit weniger Stunden mehr ein, als ein Arzt oder eine Pflegerin oder ein Lehrer
oder eine Verkäuferin draußen, wo in Peso nacional bezahlt wird, im Monat verdient.
Programmiertes Unrecht, nicht zu vermeiden in der »periodo especial«, nichtsdestotrotz paradox: Der
Tourismus als Devisenbringer Nummer zwei – nach dem Export von Nickel – hat dem sozialistischen
Gesellschaftssystem Überlebensmittel in die nach dem Ende der Sowjetunion leeren Kassen gespült.
Und zugleich das angestrebte Ziel für eine gerechte Stellung des einzelnen konterkariert, und zwar
zunehmend. »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Leistungen«?
Kuba bestreitet über 40 Prozent seiner Zahlungsbilanz aus dem Tourismus – 1990 waren es vier Prozent,
und niemand weiß, ob die Revolution überhaupt noch existierte ohne dieses Übel, das keines
wäre, gäbe es eine gerechte Weltordnung. »Während der Sonderperiode sind hier große
Ungleichheiten entstanden«, stellt Fidel fest. Und sein Buder Raúl, der Präsident, sagt, was
zunächst getan werden muß, um der Gleichheit wieder näherzukommen. Stichworte:
Agrarreform, höhere Leistungslöhne, Zusammenführung der beiden Währungen.
Soviel zur Ökonomie. Und das Bewußtsein? Die Revolution könne sich nur selbst
zerstören, meinte der damalige Staatschef in seiner berühmten Rede 2005 an der Universität
von Havanna. Er wiederholt es bis heute und zitiert – als eine Art Gegengift zu Fehlern und Schwächen
– José Marti: »Gebildet zu sein ist die einzige Möglichkeit, frei zu sein.« Und daß es
»ohne Kultur keine Freiheit« gebe. Der Comandante en jefe schlußfolgert: »Wir müssen uns erneut
verändern, denn wir haben sehr schwierige Zeiten durchgemacht, in denen Ungleichheiten und
Ungerechtigkeiten entstanden sind.« Ob des Gelingens bleibt er Optimist aus Erfahrung.
Teil 2 und Schluß in der Pfingstausgabe: Die Wiege der Revolution – Bayamo, Sierra Maestra,
Santiago, Guantánamo, Baracoa
Literatur:
Fidel Castro: »Mein Leben. Im Gespräch mit Ignacio Ramonet.« Berlin, 2008
Bodo Uhse: »Im Rhythmus der Conga«, Berlin 1964
Heinz Langer: »Kuba. Die lebendige Revolution«, Böklund 2007
 Gerd Schumann
Gerd Schumann
Junge Welt, 23.05.2009
|








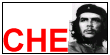


|

